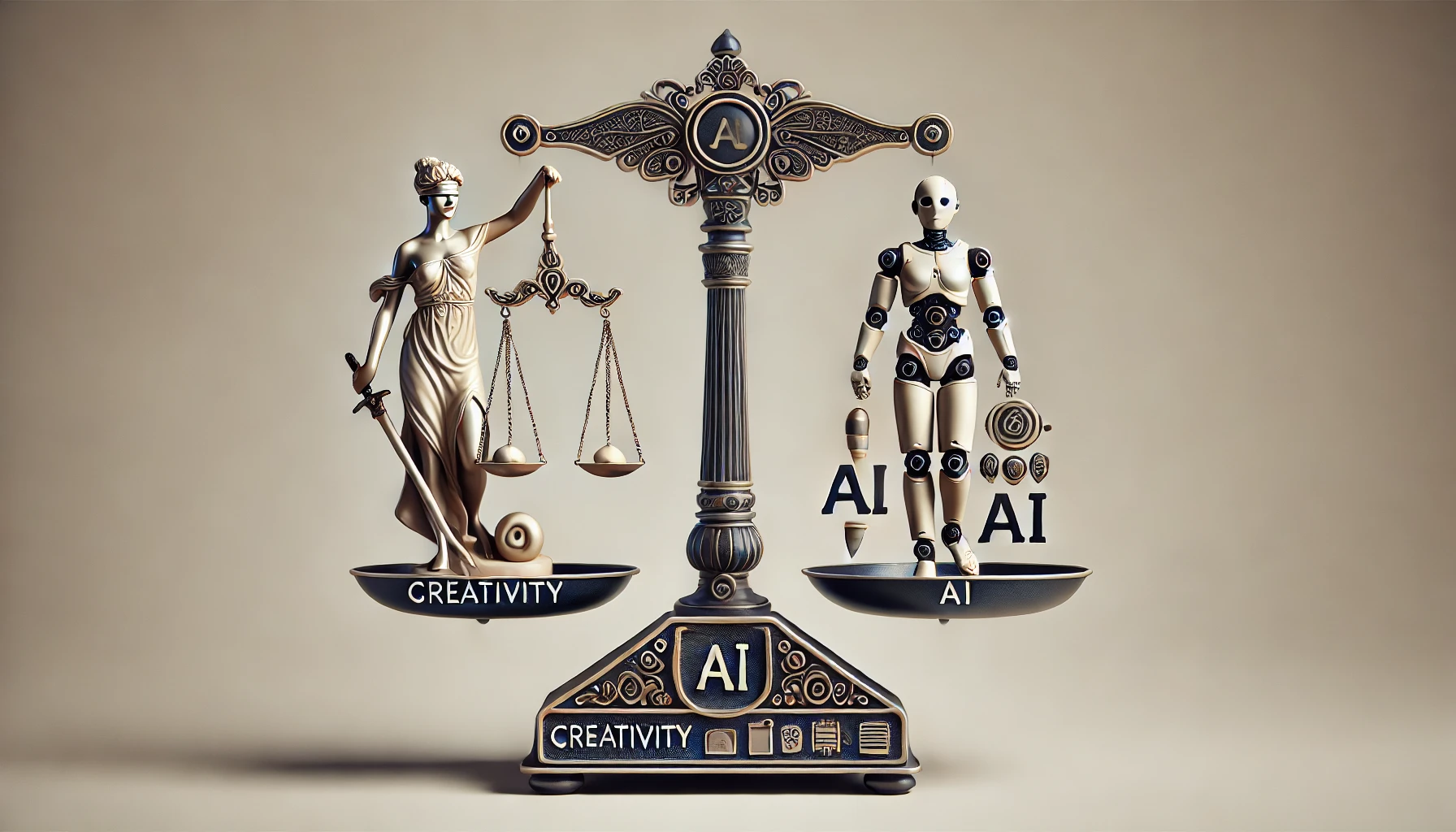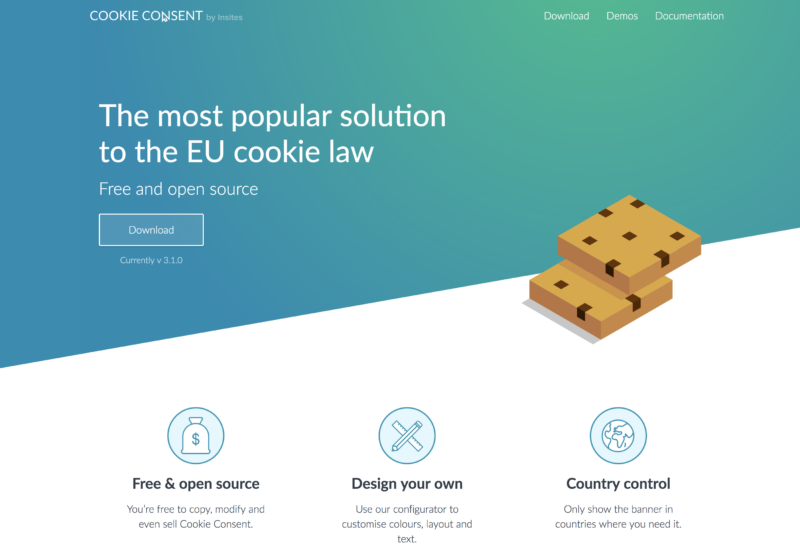KI-Bots durchforsten das Internet in Rekordzeit, saugen Wissen und geistiges Eigentum auf und nutzen es, um ihre Systeme zu trainieren oder eine Chatbot-Anfrage auf ihren Plattformen zu beantworten. Unternehmen, Wissenschaftler, Kreative und andere Anbieter wertvoller Inhalte bleiben dabei oft auf der Strecke und bekommen keine finanzielle Vergütung.
Die Bots nutzen Inhalte ohne Zustimmung, um diese als Grundlage für KI-Lösungen zu verkaufen – während die Plattformen Milliarden verdienen. Das bisherige System, bei dem Suchmaschinen Nutzer auf die Originalquellen leiten, verliert an Bedeutung. KI-Plattformen liefern Antworten direkt, ohne die Urheber zu nennen oder zu vergüten. Medienunternehmen, Wissenschaftler, technische Autoren und Künstler verlieren so Reichweite und Einnahmen.
Das Verhältnis von menschlichen Besuchern zu Bots verschiebt sich rasant: Hunderte KI-Bot-Anfragen kommen auf einen echten Besucher. Bleibt die Entwicklung ungebremst, droht ein „Maschinen-Internet“, das den menschlichen Nutzen immer weiter reduziert.
Fazit: Schutz für Urheber nötig
Ohne neue Schutzmechanismen und faire Vergütungsmodelle wird wertvolles Wissen aus dem Netz verschwinden – und das Internet könnte zu einem Raum für Maschinen statt Menschen werden.
Die Rechtliche Grundlage ist…
KI-Systeme werden mit großen Datenmengen trainiert, oft auch urheberrechtlich geschützten Werken. Dank der Urheberrechtsreform 2021 erlaubt das Text und Data Mining (§ 44 UrhG) die Nutzung solcher Werke für KI-Training ohne Zustimmung der Urheber. Um dies zu verhindern, können Urheber einen maschinell lesbaren Nutzungsvorbehalt einfügen, zum Beispiel im Impressum ihrer Website, damit Crawler ihre Inhalte nicht für Trainingszwecke verwenden.
Urheberrechtsreform 2021 und Text und Data Mining (TDM):
Die EU-Urheberrechtsrichtlinie (DSM-Richtlinie), die 2021 in Deutschland in das nationale Recht übernommen wurde, enthält Regelungen zum Text- und Data-Mining (TDM). Diese sind im deutschen Urheberrechtsgesetz (§ 44b UrhG) verankert. Sie erlauben es, urheberrechtlich geschützte Werke für TDM zu nutzen, ohne die Zustimmung der Rechteinhaber einzuholen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen:
◦ Die Nutzung muss ausschließlich zu wissenschaftlichen oder kommerziellen Forschungszwecken erfolgen (nicht für alle Zwecke).
◦ Die Werke müssen rechtmäßig zugänglich sein.
• Opt-Out-Möglichkeit für Urheber:
Urheber können die Nutzung ihrer Werke für TDM verhindern, indem sie einen maschinell lesbaren Nutzungsvorbehalt einfügen. Dies kann z. B. im Impressum der Website oder durch technische Maßnahmen (wie in der robots.txt-Datei) geschehen. Dieser Vorbehalt signalisiert, dass die Inhalte nicht für KI-Training oder TDM verwendet werden dürfen.
• Einschränkung der Anwendung: Diese Regelungen sind nicht universell: Sie gelten nicht uneingeschränkt für alle KI-Trainingszwecke. Beispielsweise können kommerzielle KI-Entwickler, die keine Forschungszwecke verfolgen, nicht automatisch auf diese Regelung zurückgreifen.
Fazit
Der genannte Paragraph ist also grundsätzlich korrekt, bedarf aber einer präzisen Einordnung: Das Text und Data Mining (TDM) ist erlaubt, aber nur in bestimmten Kontexten. Urheber, die ihre Inhalte schützen möchten, können sich durch einen Nutzungsvorbehalt dagegen absichern.
Aber ist das wirklich eine Einschränkung oder nur der Sieg des Lobbyismus über die Bürger, denn jede Ki-Firma wird sicherlich eine Forschungsabteilung haben, wie groß die sein muß wurde nicht definiert. Also ist alles erlaubt um Daten zu sammeln.
So können Sie ihre Daten und Inhalte vor KI-Bots schützen >>
Highlights zum Thema:
- Urheberrecht: KI-generierte Inhalte sind nicht urheberrechtlich geschützt, da nur Menschen Urheber sein können.
- Nutzung: Sie können frei genutzt werden, aber Nutzer haften für rechtliche Verstöße, z. B. Ähnlichkeiten mit geschützten Werken.
- Kennzeichnung: Eine Kennzeichnungspflicht besteht nur in bestimmten Fällen, z. B. für Social Media oder Deep Fakes.
- Urheberschaft: Änderungen an KI-Inhalten müssen signifikant sein, um als Urheber zu gelten.
- Kommerzielle Nutzung: Erlaubt, solange die Nutzungsbedingungen der KI-Plattform beachtet werden.
- Verträge: KI-Nutzung in Kundenaufträgen erfordert klare Regelungen zur Haftung und Nutzungsrechten.
Etwas ausführlicher:
- KI-generierte Inhalte: Mit KI-Tools wie ChatGPT, DALL-E oder Midjourney können Texte, Bilder, Logos und mehr erstellt werden. Diese basieren auf maschinellem Lernen, das mit urheberrechtlich geschützten Daten trainiert wurde.
- Urheberrecht von KI-Inhalten: Die Frage, wer der Urheber von KI-generierten Inhalten ist, ist entscheidend. Nach deutschem Urheberrecht können nur Menschen Urheber sein. Weder die KI selbst noch ihre Entwickler oder Nutzer gelten als Urheber. Somit sind KI-generierte Inhalte urheberrechtlich nicht geschützt und gelten als gemeinfrei.
- Folgen der Nutzung von KI-Inhalten: Da KI-Inhalte keinen Urheberrechtsschutz genießen, dürfen sie frei verwendet werden, ohne Lizenzgebühren oder Namensnennung. Nutzer haften jedoch für die Verwendung und mögliche Rechtsverletzungen, z. B. durch Ähnlichkeiten mit geschützten Werken.
- Risiken: KI-Inhalte können anderen Werken ähneln, was rechtliche Konsequenzen haben kann. Zudem besteht das Risiko, dass andere Nutzer den gleichen Prompt eingeben und identische Inhalte erhalten.
- Kennzeichnungspflicht: Eine generelle Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte gibt es nicht. Für Social Media und spezielle Anwendungen (wie Deep Fakes oder öffentliche Angelegenheiten) gelten jedoch bereits Kennzeichnungsvorschriften.
- Urheber von KI-generierten Inhalten werden: Nutzer können durch signifikante Änderungen an KI-Inhalten Urheberrechte erwerben, aber einfache Modifikationen reichen dafür nicht aus. Die individuelle kreative Leistung ist entscheidend.
- Kommerzielle Nutzung: KI-generierte Inhalte können grundsätzlich kommerziell verwendet werden. Es sollte jedoch sichergestellt werden, dass die Nutzungsbedingungen der jeweiligen KI-Plattform eingehalten werden.
- Verträge und Haftung: Wenn KI-Inhalte für Kunden erstellt werden, kann es zu Problemen kommen, da keine Nutzungsrechte übertragen werden können. Haftungsfragen sollten vertraglich geklärt werden.
Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie in einem Artikel bei www.erecht24.de